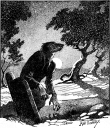Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 hat sich der geographische Mittelpunkt der Bundesrepublik nach Osten verschoben. Legt man die äußersten Längen- und Breitengrade von Deutschlands Grenzen zugrunde, so treffen sich die Koordinaten nahe dem thüringischen Ort Niederdorla. Andere Messsysteme führen zu anderen Ergebnissen, doch in unserem Fall hat schriftstellerische Fiktion Vorrang vor landesvermesserischer Rechthaberei. Florian Russis gleichnishafte Geschichte spielt auf der Wartburg und im nahegelegenen Niederdorla als zentralem Punkt deutscher Geschichte und Zukunftsvision.
Uta Plisch
Einst lebten auf der Wartburg die Grafensöhne Udo und Bernward. Udo entstammte einem hessischen Adelsgeschlecht. Seine Eltern waren früh verstorben. Deshalb wurde er am Hof seiner Tante, der Frau des Landgrafen von Thüringen, großgezogen. Bernward war der Sohn eines sächsischen Grafen. Er war illegitim und von seinem Vater der Landgräfin zur Erziehung anvertraut worden.
Die beiden waren etwa gleichaltrig und von Kindheit an eng miteinander verbunden. Sie spielten, balgten, lernten gemeinsam und verhielten sich wie Zwillingsbrüder.
Als sie älter wurden, ritten sie häufig gemeinsam aus, um Land und Leute in Thüringen kennenzulernen und vieles Neue zu erleben. Eines Tages kamen sie so nach Niederdorla, einem kleinen Dorf, das damals nur aus wenigen Häusern bestand. Am Rande des Ortes stand ein Forsthaus, in dessen Vorgarten sich ein großer Brunnen befand. Da Udo und Bernward durstig waren, baten sie eine alte Frau, die vor dem Forsthaus ihre Blumen netzte, aus dem Brunnen trinken zu dürfen.
Sie erlaubte es ihnen gern, und als sie getrunken hatten, sagte sie zu ihnen: »Der Ort, an dem ihr euch jetzt befindet, wird einmal der Mittelpunkt Deutschlands sein.«
Neugierig überschütteten sie die alte Frau mit Fragen, und sie erzählte ihnen viele Geschichten, die sich im Forsthaus und am Brunnen zugetragen hatten. Die Erzählungen waren voller Mythen und Weisheiten. Bis in den späten Abend hörten Udo und Bernward ihr zu, und aus der Begegnung entwickelte sich eine herzliche Freundschaft.
Von da an wurde das Forsthaus für die beiden Grafensöhne immer wieder zum Ziel ihrer Ausritte. Die Frau war die Witwe eines verdienstvollen Försters, und der Landgraf hatte ihr erlaubt, das Haus weiter zu bewohnen. Nicht oft kamen Besucher zu ihr. Umso mehr freute sie sich, wenn die beiden Burschen bei ihr anklopften, ihr zur Hand gingen und sie mit neugierigen Fragen überhäuften.
Immer wieder staunten sie über das, was die Försterswitwe, die sie bald nur noch »Mutter Anna« nannten, über das Leben und seine Begebenheiten zu berichten wusste. Zwei Jahre pflegten die drei diese Freundschaft, dann mussten Udo und Bernward Abschied nehmen.
Zwei Boten kamen eines Tages zur Wartburg geritten, um Udo, der inzwischen volljährig geworden war, abzuholen und zum Schloss seiner verstorbenen Eltern zu bringen. Dort hatte bis dahin sein Vormund Franz, ein Bruder seines Vaters, für ihn regiert.
Auch Bernwards Tage auf der Wartburg gingen ihrem Ende zu. Er wurde von seinem Vater erwartet, in dessen Dienste er nun treten sollte.
Als sich die beiden von Mutter Anna verabschiedeten, gaben sie ihr das Versprechen, sie in jedem Jahr am Johannistag zu besuchen und ihr dann von ihrem neuen Leben zu erzählen.
Keiner der drei zweifelte daran, dass sie sich im folgenden Jahr wiedersehen würden. Doch als der Johannistag herangekommen war, wartete Mutter Anna vergebens auf ihre jungen Freunde. Auch traf keine Nachricht bei ihr ein. Die beiden sind zu sehr mit ihren neuen Lebenswelten beschäftigt, dachte die Försterswitwe und war sehr traurig.
Als sie auch in den folgenden Jahren kein Lebenszeichen von Udo und Bernward erhielt, meinte sie, dass wenigstens einer von ihnen sie hätte besuchen können. Sie war sehr betrübt, wollte sich aber nicht vorstellen, sich im Charakter der beiden getäuscht zu haben. Jeden Abend betete sie zu Gott, dass es den zweien gut gehen möge.
Eines Tages hörte sie Stimmen und Pferdegewieher vor ihrem Haus. Aufgeregt lief sie zur Tür, doch waren nicht die gekommen, die sie sich erhofft hatte. Immerhin war es der deutsche Kaiser Heinrich, der mit seinem Gefolge unterwegs war und in der Nähe des Forsthauses Rast hielt.
»Dürfen meine Leute Wasser aus Eurem Brunnen schöpfen?« fragte der Kaiser höflich, und Mutter Anna lud ihn freundlich ein, sich zu bedienen und ein wenig am Brunnen zu verweilen. »Der Ort, an dem der Brunnen sich befindet, wird einmal der Mittelpunkt Deutschlands sein«, versicherte sie auch ihm.
»Alle meine Sinne sagen mir: Es ist etwas Besonderes an diesem Ort«, erwiderte Kaiser Heinrich, und seine Augen schienen in die Ferne zu blicken. Dann sprach er wie im Traum zu den Umstehenden: »Von diesem Punkt aus, an dem sich einmal die Mitte Deutschlands befinden wird, will ich versprechen, dass mir die Bewohner meines Reiches alle gleich wichtig sind und ich gegenüber jedermann Gerechtigkeit walten lassen und niemanden unberechtigt bevorzugen will. Von hier aus ergeht aber auch mein Appell an unsere Landsleute, sich brüderlich zu begegnen und zu achten. Nur im Glück seiner Bewohner kann das Reich gedeihen.« Dann rief er seine engsten Gefolgsleute zusammen und hielt mit ihnen Rat.
»Dies ist auch der Ort, um richtige Entscheidungen zu treffen«, sagte er zu seinen Getreuen.
Bevor der Kaiser einige Tage später zur Weiterreise aufbrach, wollte er sich persönlich von Mutter Anna verabschieden; er hatte die Frau sehr lieb gewonnen. Doch er und seine Leute fanden sie tot in ihrem Haus. Ihr altes Herz hatte die Aufregungen der vergangenen Tage nicht verkraftet.
Heinrich trauerte um sie und ließ sie in der Nähe des Forsthauses bestatten. Auf ihr Grab pflanzte er eine Linde, und daneben wälzte er einen schweren Stein. Einmal noch trank der Kaiser aus dem Brunnen, dann befahl er den Aufbruch.
In den folgenden Jahren verfiel das alte Forsthaus, und der Brunnen davor versiegte. Niemand nahm Anteil daran. Mutter Anna hatte keine Erben hinterlassen, und die von ihr so geliebten Grafensöhne kamen nicht mehr zu diesem Ort. Dafür gab es Gründe.
Als Udo von den beiden Boten zum Schloss seiner verstorbenen Eltern gebracht wurde, hatte man ihn dort nicht mit den erwarteten Ehrenbezeugungen empfangen. Sein Onkel und Vormund Franz dachte nicht daran, die Herrschaft an seinen Neffen abzutreten. Er ließ den Ahnungslosen ins Gefängnis werfen, kaum dass er das Schloss betreten hatte. Dort ließ er ihn bei Wasser und Brot darben und jedermann bei Hof verbieten, mit ihm in Verbindung zu treten. Nur Josefa, die geistig zurückgebliebene kleine Tochter eines Hofbediensteten, kam täglich zu Udos Zelle und schaute mit neugierigen Augen durch das Gefängnisgitter. Manchmal brachte sie ihm etwas Gemüse, Fleisch oder auch Wein mit. Dann freute sie sich, wenn Udo ihr von Herzen dankte und sie sein »Leben« nannte.
Immer, wenn sie ihn besuchte, erzählte er ihr Geschichten von der Wartburg oder vom Forsthaus und von Mutter Anna. Vieles davon konnte sie in ihrer Einfalt nicht verstehen, doch lächelte sie zufrieden, wenn er mit ihr redete. Für ihn waren ihre Besuche das höchste Glück.
Nach einigen Jahren teilte der Gefängnisaufseher dem Grafen Franz mit, dass sein Neffe am Erblinden sei. Das Stroh und der Unrat, in denen er sich Tag und Nacht aufhalten musste, hatten zu einer schweren Entzündung seiner Augen geführt. »Möge der Kerl nichts mehr sehen und verrecken«, gab Franz zur Antwort. Der erste Wunsch des unrechtmäßigen Schlossherren ging in Erfüllung. Udo verlor sein Augenlicht. Josefa aber besuchte ihn weiterhin und lauschte seinen Geschichten.
Bernward dagegen war am Hof seines Vaters freundlich empfangen worden. Sein Erzeuger verfolgte ein ehrgeiziges Ziel mit ihm. »Da du nicht mein ehelicher Sohn bist, kannst du nicht meinen Thron erben. So will ich dir stattdessen Gelegenheit geben, an der berühmten Universität von Bologna zu studieren und ein Herrscher des Geistes zu werden. Durch dich hoffe ich, einmal zu bedeutenden Künstlern und Gelehrten in Verbindung treten zu können.«
Ausgestattet mit viel Geld und höchsten Empfehlungen machte sich Bernward auf den Weg nach Bologna. Dort traf er Aloysius, einen weiteren jungen Sachsen, mit dem zusammen er Quartier bezog. Bernward entdeckte sein Interesse an Bibliotheken und allem, was dokumentiert und schriftlich überliefert war. Oft ließ er sich nachts in Büchereien einschließen, um ungestört bei Kerzenschein lesen und studieren zu können.
Bei einer Geselligkeit lernte er den Bibliothekar des Grafen Enno von Mercato kennen. Gegen ein großzügiges Entgelt erlaubte dieser ihm, mehrere Tage und Nächte in der ehrgeizig ausgestatteten Bibliothek seines Herrn zuzubringen. Irgendwann wurde Bernward dabei von Müdigkeit übermannt und schlief ein, während die neben ihm stehende Kerze weiterbrannte. Im Schlaf musste er sie umgestoßen haben. Als er jäh erwachte, stand ein Teil der Bücher in Flammen. Zwar gelang es ihm, das Feuer zu ersticken, doch war ein beträchtlicher Schaden entstanden.
Als Graf Enno von dem Vorfall erfuhr, ließ er Bernward ins Gefängnis werfen und befahl dem von ihm eingesetzten Richter, ihn empfindlich zu bestrafen. Doch Bernward, der aufgrund seiner Herkunft auf Fürsprachen und ein mildes Urteil hoffte, wartete vergeblich auf seinen Prozess. Inzwischen nämlich war Graf Enno von einem Nebenbuhler ermordet worden, und in den langen Wirren um seine Nachfolge geriet Bernwards Fall in Vergessenheit. Mehr als zehn Jahre dauerten die Machtkämpfe in der kleinen Grafschaft. Kein ordentliches Gericht kam zustande. Nur die Gefängnisverwaltung arbeitete zuverlässig. So brauchte es ein zwölftes Jahr, bis Bernward endlich vor einen Richter geführt und ohne viel Aufhebens in die Freiheit entlassen wurde.
Niemand hatte ihn im Gefängnis vermutet und dort nach ihm gesucht. Als er vier Wochen nach seiner Abreise aus Bologna nicht in das gemeinsame Quartier zurückgekehrt war, hatte sein sächsischer Landsmann Aloysius Bernwards Geld an sich genommen und behauptet, der Grafensohn sei einer unbekannten Geliebten nach Neapel nachgereist. Am Hof seines Vaters hatte man ihn daher als verschollen betrachtet.
Umso glücklicher schloss dieser ihn wieder in die Arme. Er ließ ihm einen fröhlichen Empfang bereiten und ernannte ihn zum Leiter aller wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen seines Landes.
Bernward wurde ein treuer und gewissenhafter Beamter. Doch als er ein Jahr später in seinem Kalender sah, dass der Johannistag bevorstand, ließ er alle Verpflichtungen hinter sich, schwang sich auf ein Pferd und setzte es in Richtung Niederdorla in Trab. »Udo und Mutter Anna werden mich in den vergangenen Jahren für treulos gehalten haben«, sagte er zu sich und trieb sein Pferd mit beklommenem Herzen zur Eile.
Ähnliche Gedanken hatte zum selben Zeitpunkt auch Udo, der Freund aus alten Tagen. Wenige Monate zuvor war eine Wachmannschaft zu ihm ins Gefängnis ge kommen, hatte ihn befreit, stattlich eingekleidet und in den Thronsaal des Schlosses geführt.
Dort waren die Notabeln des Landes vorgetreten, um ihm den Treueid zu leisten. Tage zuvor war Graf Franz vom Pferd gestürzt und hatte sich das Genick gebrochen. Nun war Udo nicht nur der legitime, sondern auch der einzig verbliebene Anwärter auf das Grafenamt. Durch weitere Erbschaften war er zudem zu einem reichen und mächtigen Fürsten geworden.
Die, welche ihn zuvor nicht beachtet hatten, liebedienerten nun um ihn herum, schmeichelten ihm und legten ihm nahe, sich bald zu verheiraten und gesunden Nachwuchs zu zeugen. Ärzte umsorgten ihn, doch sein Augenlicht konnte ihm keiner zurückgeben.
»Wie lange dauert es noch bis zum Johannistag?« fragte Udo eines Tages einen Begleiter. »In einer Woche findet das Fest statt«, antwortete dieser. »Sattle mir ein weißes Pferd und lasse den Schmied zu mir kommen«, befahl ihm Udo.
Als der Schmied eintraf, sagte er zu ihm. »Passe mir die beste Rüstung an, die du in deinem Bestand hast. Morgen schon will ich zu einem Ort reiten, der mir in meiner Jugend viel bedeutet hat. Es ist der Ort, der ausersehen ist, die Mitte Deutschlands zu werden.«
»Dann ist die Rüstung, die ich Euch jetzt anpassen werde, genau die richtige«, antwortete der Schmied. Kaum hatte Udo sie angelegt und das weiße Pferd bestiegen, da eilten er und das Tier wie magisch angezogen in schnellem Trab in Richtung Niederdorla. »Lasst mich alleine«, hatte er zu seinen Dienern gesagt. »Ich weiß, dass mir kein Unglück geschehen wird.« Die, welche ihn vorbeireiten sahen, glaubten ein Gespenst zu sehen und machten sich eiligst aus dem Staub.
Als Udo nach mehreren Tagen dort eintraf, wo sich nur noch wenige Mauerreste und ein versandeter Brunnen befanden, stand Bernward traurig im Schatten der von Kaiser Heinrich gepflanzten Linde. Schon beim ersten Anblick des Ortes war ihm klar geworden, was sich da ereignet haben musste. »Danke für alles, liebe Mutter Anna«, sagte er leise. Dann wendete er den Kopf und sah den seltsamen Ritter auf sich zukommen. Sofort dachte er, dass dies nur Udo sein konnte.
»Das Schicksal hat unsere Träume zerstört«, stellte Udo fest, nachdem sie sich umarmt und von ihren Erlebnissen berichtet hatten. »Dennoch habe ich jetzt mehr Macht, als ich mir früher je hätte vorstellen können. Nur lesen kann ich nicht und nicht sehen. Immer werde ich auf Hilfe angewiesen sein. Du bist gesund und hast dir mehr Wissen aneignen können, als die meisten Herrscher oder Höflinge je besitzen werden. Lass uns an diesem Ort nachdenken und neue Pläne schmieden. Dabei will ich auch die junge Frau nicht vergessen, die mir oft aus meiner Verzweiflung geholfen hat. Sie hat klare blaue Augen, aber oft weiß oder versteht sie nicht, was sie sieht. Für mich jedoch hat sie in den vielen Jahren trostloser Einsamkeit mehr bedeutet, als viele kluge Weiber.«
»Für jeden von uns muss es einen Platz geben«, antwortete Bernward. »Hier, an diesem Ort, ist nichts mehr, wie es früher war. Die Erinnerung aber ist uns geblieben. Ich höre Mutter Anna zu uns sprechen: Beratet euch und tut das Richtige!«
*****
aus: Florian Russi, Der Drachenprinz, Bertuch-Verlag Weimar 2004.
Zeichnung: Dieter Stockmann