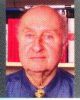Oder: Die unfreiwilligen Partner
Ein Filmkritiker erzählte neulich, er habe seinem Sohn eine klassische amerikanische Leinwand-Komödie vorgeführt. Den Titel habe ich vergessen. In dem Film geht es um einen Unternehmer, der sich für so unentbehrlich hält, dass er aus jedem Restaurant oder Büro, das er gerade aufsucht, sofort an seine Zentrale die Telefonnummer durchsagt, damit man ihn jederzeit erreichen kann. Dieser Zwang, ständig eine Positionsmeldung zu senden, gebiert manchen Gag, über den das damalige Publikum geradezu Tränen lachte. Der Sohn, ganz Kind unserer Zeit, verzog keine Miene und fragte nur verständnislos, warum der hektische Typ denn nicht sein Handy benutzte.
In der Tat, das heutige Leben ist ohne das mobile Telefon in jedermanns Hand kaum noch zu denken. Gerät einer mal in ein Funkloch, so empfindet er das schon als gehörigen Schicksalsschlag. Etwa jeden zweiten Passanten in der Stadt trifft man mit der Hand am Ohr an, selbst beim Überqueren einer Straße oder beim Lenken eines Autos wird telefoniert, auch wenn die Polizei mit dem Auge des Gesetzes streng dreinblickt und danach fleißig Strafzettel ausfertigt. Wie konnten wir nur leben und lieben, als das Telefonino, wie die Italiener es zärtlich-korrekt nennen, noch nicht erfunden war? Wie konnten wir Verabredungen treffen oder auch kurzfristig absagen?
Das Handy, wie wir es in alberner Sucht zu Anglizismen Fälschlich bezeichnen, war vor wenigen Jahrzehnten noch ein kaum zu denkender Zukunftstraum. Aber
auch das gewöhnliche Telefon, das seit dem 19. Jahrhundert bereits existiert und stetig an Bedeutung gewann, war ein rarer Luxusartikel - jedenfalls in der damals noch real existierenden DDR. Ob es an Kabeln mangelte oder an Personal oder vielleicht auch an gutem Willen, ein Telefon für jeden Haushalt war nichts als eine kühne Vision.
Nun wollte und sollte ich als Journalist für meine Redaktion eigentlich jederzeit erreichbar sein, um auf aktuelle Ereignisse sofort reagieren zu können. Also machte ich mich mit einer so genannten Dringlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers auf den Weg zum Fernsprechamt.
Die Bearbeiterin durfte daraufhin meinen länger schon schlummernden Antrag aus einer Mappe in eine andere legen. Aber hinter der vorgehaltenen Hand gab sie mir zu verstehen, dass meine Chancen damit nur unwesentlich gestiegen seien, weil so gut wie keine neuen Anschlüsse bereitgestellt würden.
Was also tun? Im Lande der Mangelverwaltung hatten die Techniker des Telefonwesens Ideen für Notpläne entwickelt. Im Sparzwang nämlich hatte man ersonnen, einen schon bestehenden Anschluss doppelt zu nutzen. Da wurden zwei Fernsprechkunden gewissermaßen an den gleichen Strang gehängt, also miteinander verkuppelt; irgendwo spaltete sich die Leitung, ein Draht führte in Wohnung A, ein anderer in Wohnung B. Die beiden Teilnehmer mussten sich einen Anschluss teilen, jeder hat nur quasi ein halbes Telefon, denn während beispielsweise Herr A. ein Gespräch führte, war Telefon B nicht benutzbar. Obwohl die Nutzung eingeschränkt war, verlangte die Behörde von beiden den vollen Preis. Das war sicher nicht korrekt, aber niemand beschwerte sich: Lieber ein halbes Telefon als gar keins.
Natürlich hatte jeder seine eigene Nummer, die sich von der des unfreiwilligen Partners nur in ein oder zwei Ziffern unterschied. Eines aber war sogleich ersichtlich:
Ein so genannter Zweieranschluss in Ostberlin besaß sieben Ziffern, während damals allgemein noch sechs Ziffern üblich waren. Man konnte ihn also erkennen, auch wenn aus gutem Geheimhaltungsgrund der andere Partner nicht zu verifizieren war. Das hätte ja wegen allzu langen Schwätzens schließlich manche Zivilklage zur Folge haben können.
Die Sache mit den sieben Ziffern wollte ich mir zunutze machen. Ich hörte mich in der Gegend um, wer in meiner Nähe Fernsprechteilnehmer wäre. Nun musste ich nur noch im Telefonbuch nachschlagen und die Ziffern zählen. Und siehe, da besaß doch im Nebenhaus tatsächlich noch einer den noblen Einzelanschluss. Sogleich schrieb ich ein artiges Brieflein an die Behörde, man möge doch prüfen, ob sich da für mich als dringlichen Bewerber ein Zweittelefon abzweigen ließe. Anstelle eines Antwortbriefes erhielt ich einen Postkarten-Vordruck mit der Kurzmitteilung, wie meine künftige Rufnummer laute und wann der Montagetrupp zu erwarten sei. Und an besagtem Tage meldete sich meine Frau fernmündlich mit der neckischen Frage: Rate mal, von wo ich telefoniere? Na klar - aus dem heimischen Wohnzimmer.
Unsere Familie wuchs, wir zogen um, und damit befanden wir uns erneut im schalltoten Winkel. Aber ich hatte ja schon meine Erfahrungen und begann das Spiel aufs Neue: Recherchen in der Umgebung, Briefchen an das Fernsprechamt, und es kam tatsächlich die noch immer gleiche Vordruckkarte. Das Problem schien gelöst.
Wir bekamen ein Telefon, Nummer siebenstellig.
Eines Tages stand ein untersetzter, zornesroter Mann vor unserer Tür, schimpfend und finstere Drohungen ausstoßend. Seinem erregten Monolog ließ sich entnehmen, dass er eine wichtige Person in einem bedeutenden Unternehmen sei, ich hingegen ein gewissenloser Bürger, der durch seine Handlungsweise beinahe einen schlimmen Störfall ausgelöst habe. Im Klartext bedeutete das: Der Mann hatte am Wochenende Telefonbereitschaftsdienst als Chef der Sicherheit, aber die Kontrollan- rufe seiner Behörde waren ins Leere gelaufen, denn seine Rufnummer hatte sich geändert. Der Mann war mein unbekannter Telefonzwilling. Das Amt hatte vergessen, ihm den seltsamen Wandel seines Geräts und seine neue Nummer mitzuteilen. Woher der Mann wusste, wer ihm seinen Anschluss halbierte, habe ich nicht erfahren. Aber für einen Sicherheitschef war dieses amtliche Geheimnis sicher leicht zu enträtseln. Jedenfalls hielt er mich für den allein Schuldigen.
Die einfachste Übung schien der nächste Umzug mit sich zu bringen. Wir tauschten unsere Wohnung, der Tauschpartner war ebenfalls Fernsprechteilnehmer, also mussten wir nur unsere Anschlüsse ummelden. So dachte ich jedenfalls in meiner Einfalt. Für eine Behörde stellt sich diese Aufgabe komplizierter dar. Ich bekam einen
mehrseitigen Antrag zum Ausfüllen, das gleiche Papierbündel für meinen Tauschpartner. Wer ich sei und was ich wolle, das musste in mindestens drei Dutzend Rubriken erklärt und durch detaillierte Antworten auf Fragen von sinnverwirrendem Bürodeutsch belegt werden. Wir Antragsteller taten unser Bestes, und fortan konnten wir unbeschwert telefonieren.
So glaubten wir wenigstens. Die große Überraschung kam mit der nächsten Rechnung. Ich möchte doch bitte mein Konto so weit aufstocken, dass man die Fälligen Gebühren abbuchen könne, schrieb die Behörde. Ich sei zwar kein reicher Mann, entgegnete ich, sondern nur mäßig bezahlter Journalist, aber für die Telefongebühren reiche der Kontostand jederzeit aus. Man möge doch noch einmal prüfen, ob die richtige Kontonummer gewählt wurde.
Der nächste Brief war ein Entschuldigungsschreiben, allerdings wurde ich darin mit dem Namen meines Tauschpartners angeredet. Im Antwortschreiben nannte ich sicherheitshalber noch einmal meinen Namen und die richtige Kontonummer. Daraufhin wurden mir die Gebühren meines früheren Telefons, also die Gespräche meines Tauschpartners, in Rechnung gestellt. Abermaliger Briefwechsel: Wie ich heiße, wo ich wohne, wie meine Rufnummer lautet. Der gesamte Briefwechsel dauerte etwa ein Dreivierteljahr an, bis alle Unklarheiten beseitigt waren. Offenbar war der behördliche Fragebogen, der dem Wirrwarr vorausging, nicht nur für den schlichten Bürger, sondern auch für die Behörde ein Hindernisparcour der höheren Schwierigkeitsstufe.