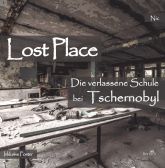„Papachen" bestohlen
Liszt spielte in Wahnfried seine Faust-Symphonie aus der Partitur. Das Hauptthema des ersten Satzes ist das notengetreue Ebenbild eines Motivs am Schluss des zweiten Aktes der „Walküre". Wagner hatte das Werk vor Jahren gründlich studiert, wovon ihm offenbar dieses eindrucksvolle Motiv haften blieb, so dass er es in seinem Werke absichtlich oder absichtslos verwendete. Als das Thema erklang, eilt Wagner ans Klavier zu Liszt und fragt lachend: „Du, Papachen, das habe ich dir ja gestohlen!" Der neidlose Liszt erwidert schlagkräftig: „Nun, das ist recht, da hört ´s doch wenigstens jemand!" (Aus Wilh. Rienzl, Meine Lebenswanderung)
Wenn Fürsten sprechen
Liszt spielte einst am Petersburger Hof. Der Zar unterhält sich während des Vortrags mit seiner Nachbarin. Eine Weile bekämpft Liszt seinen Ärger, als aber die Unterhaltung immer angeregter und lauter wird, bricht er plötzlich mitten im Spiel ab. Verwundert schaut der Fürst auf und fragt nach der Ursache. Und Liszt antwortet mit einer tiefen Verbeugung: „Wenn Fürsten sprechen, haben die Diener zu schweigen."
Wortspiel
Hans Abt besuchte einmal mit Liszt zusammen die Walküre und bemerkte an einer Stelle, dass hier Verbesserungen angebracht werden müssten. Liszt meinte darauf sarkastisch: „Dann wäre es aber kein Walkürenritt mehr, sondern ein Abt-Ritt."
Zwei Castings
Auch Liszt hatte seine Sprüche drauf.
Felix Weingartner erzählt in seinen „Akkorden", wie er bei seinem ersten Besuche bei Liszt diesen über das schlechte Spiel eines jungen Mannes so aufgeregt fand, dass er die Noten auf die Flügeldecke warf und in höchster Wut ausrief: „Glauben Sie, dass ich dazu da bin, Ihre ungewaschene Wäsche zu waschen?"
Ein andermal, da ihn eine junge Dame durch den dilettantenhaften Vortrag einer chopinschen Ballade halb zur Verzweiflung gebracht hatte, sagte er, die Hand wie segnend auf Haupt legend, leise: „Heiraten Sie bald, liebes Kind! Adieu!"
Wert der Kunst
Von einem reichen, aufdringlichen Gastgeber wurde Liszt gleich nach Tisch zum Spielen genötigt. Er ging zum Klavier, machte eine Glissando die Tastatur hinauf, die Tastatur hinab, schloss dann das Instrument und entfernte sich mit den Worten: „So, mein Dinner ist bezahlt."
----
Textquelle: Hans Hollerop, Musiker-Anekdoten, Verlag J. Engelhorns Nachfl., Stuttgart 1927
Bildquelle: Franz Liszt, wikipedia - gemeinfrei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:LisztLitho.JPG&filetimestamp=20060122163928